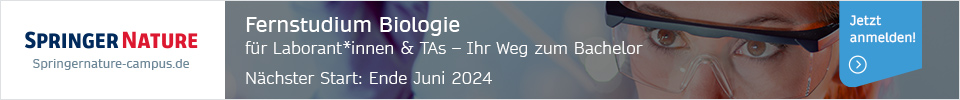Alles schon bezahlt
(5.5.15) Open-Access-Publikationen kosten den Steuerzahler weniger als Journal-Abos, pro Artikel gerechnet. Eine flächendeckende Umstellung auf Open Access wäre also ohne Mehrkosten möglich, rechnet die Max Planck Digital Library vor.
Open-Access-Publikationen sind nicht nur für alle frei zugänglich, im Gegensatz zu den traditionellen Abo-Journalen. In der Summe kommen die beim Bezahl-Modell des sogenannten Gold Open Access meist anfallenden Publikationsgebühren auch billiger als die Kosten für Zeitschriften-Abonnements. Das rechnen Ralf Schimmer, Kai Karin Geschuhn und Andreas Vogler von der Max Planck Digital Library in einem "White Paper" vor.
Die vollständige Umstellung auf Open-Access wäre also schon mit den heute bereit stehenden Mitteln finanzierbar, so die Max-Planck-Bibliothekare.
5000 Euro pro Artikel
Weltweit werden pro Jahr etwa 7,6 Milliarden Euro für Journal-Abos ausgegeben. Der Gegenwert, den die Wissenschaftsverlage dafür liefern, sind etwa 1,5 Millionen bei Web of Science gelistete Artikel. Das traditionelle Abo-Modell kostet also etwa 5000 Euro pro Artikel (etwas weniger, wenn man auch solche Fachartikel einbezieht, die nicht bei Web of Science erscheinen).
Wie viel kostet im Vergleich dazu der durchschnittliche Open-Access-Artikel? Die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, denn es ist nicht sicher, auf welchem Preisniveau sich die "APCs" (Article Processing Charges, also die Servicegebühr für die Publikationsleistung) letztendlich einpendeln werden. Aber, so das Max-Planck-Papier, man dürfe davon ausgehen, dass die durchschnittlichen Kosten für ein Open-Access-Paper bei maximal ca. 2000 € liegen.
Wer soll das bezahlen?
Es wäre also genug Geld im System um den vollständigen Übergang zu Open Access zu finanzieren. Selbst dann, wenn Forscher in einer zukünftigen "Open-Access-Welt" vielleicht etwas mehr publizieren als im gegenwärtig noch vorherrschenden Abo-Modell.
Das Problem ist nur: Die Abo-Journale verschwinden nicht über Nacht und belasten weiterhin die Budgets der Bibliothekare. Wo also soll das Geld herkommen, um zusätzlich zu den laufenden Abo-Kosten die APCs für frei zugängliche Paper zu bezahlen? Die Schlussfolgerung aus dem White Paper der Max Planck Digital Library ist naheliegend: Zusätzliche Mittel für Open Access müssten nur konsequent von den Töpfen für traditionelle Journal-Abonnements abgezwackt werden.
Aber wie könnte diese Übergangsphase in der Praxis aussehen? Bibliotheken könnten Abos oder ganze Abo-Bündel nach und nach kündigen. Aber wie kommen die Forscher dann an ihre Fachartikel? Oder die Bibliothekare müssten günstigere Deals mit den Großverlagen aushandeln. Das aber steht diametral zur Vorstellung der großen Verlage. Die setzen zwar auch auf Open Access, manche wohl eher notgedrungen als ehrlich begeistert. Und oft mit etwas fragwürdigen "Hybrid"-Modellen, bei denen frei zugängliche und Bezahl-pflichtige Artikel in derselben Zeitschrift erscheinen.
Daneben aber möchten die Alt-Verleger vor allem stetige Preiserhöhungen für ihre traditionellen Journals durchsetzen. Denn von den sensationellen Gewinn-Margen dieses Geschäftsmodells will man sich offensichtlich ungern früher als unbedingt nötig verabschieden.
Würden die Verlage wirklich ihre Preise senken, falls Universitäten und Forschungseinrichtungen in großer Zahl beschließen, ihr Budget zugunsten neuer Open-Access-Töpfe umzuschichten (und deshalb mit Abo-Kündigungen drohen)? Oder erfinden sich die Alt-Verlage gar ein Stück weit neu und setzen selbst ganz auf Open Access?
Wider die Preistreiberei
Dass Bibliotheken und auch ihre Kunden, die Forscher, immer weniger bereit sind, das preistreibende "Weiter so" der Verlage hinzunehmen, haben zwei deutsche Universitäten schon bewiesen. Sowohl die Uni Konstanz als auch die Uni Leipzig haben ihre Vereinbarungen mit dem Verlagsgiganten Elsevier gekündigt (siehe hier). Sollten diese Beispiele Schule machen, wäre der erste Schritt hin zur Open-Access-Ökonomie getan.
Spannend auch die Frage, ob der Sog neuer, frei zugänglicher "Megajournals" wie PLOS ONE oder PeerJ spezialisierte Abo-Journals zum Aufgeben zwingt – und damit den Übergang zu Open Access katalysiert. Denn gerade für Autoren kleiner Studien mit "negativen" oder nicht ganz eindeutigen Ergebnissen sind diese neuartigen Journals mit ihren niedrigen Hürden eine attraktive Alternative zu den traditionellen Nischenblättchen.
Einige der etablierten "Community Journals" satteln selbst auf freien Zugang um und entlasten damit auch die Bibliotheks-Budgets. Aber längst nicht alle akademischen Journal-Herausgeber wollen diesen Weg gehen. Eine spezialisierte, aber prestigereiche Fachzeitschrift ist eine ertragreiche Einnahmequelle – nicht nur für den Verlag, sondern auch für wissenschaftliche Fachgesellschaften, die häufig als Herausgeber fungieren und am Gewinn beteiligt sind.
Es bleibt also schon noch etwas unklar, wie der weitere Weg in die Open-Access-Zukunft aussehen könnte. Auch wenn das Geld dafür tatsächlich schon da ist.
Hans Zauner
Illustration: FotoDesignPP / Fotolia